Das Dunkel unter dem Bett – Von der Irrationalität unserer Ängste – Frederieke Lohmann
Ein kalter Schauer, eine Schweißperle rinnt die Stirn herunter. In der Magengrube breitet sich ein flaues Gefühl aus. So oft hat sie einen nicht schlafen lassen, Nacht um Nacht hat man sich ihretwegen um die Ohren geschlagen. Manchmal ist es nur ein kleines Geräusch, wenn man alleine zuhause ist, ein andernmal hätte man den neuesten Horrorstreifen vielleicht doch lieber nicht spätabends anschauen sollen, und ein weiteres Mal hat man gerade die Zeitung in der Hand, die tagtäglich von immer neuen Gräueltaten berichtet. Angst ist allgegenwärtig und kommt in den verschiedensten Formen vor, von nackter Panik bis hin zu sublimem Gefühl – ihr Facettenreichtum ist endlos.
Angsthase, Baby, Schisser, schelten wir uns ein ums andere Mal, wenn sie uns scheinbar jeglichen rationalen Verstand vernebelt. Angst gilt als kindlich, naiv, ja geradezu als Schwäche, denn ein wahrer Mann hat keine Angst – doch ist dies tatsächlich der Fall? Sind unsere Ängste wirklich so lachhaft und irrational, wie es zuweilen den Anschein hat?
Zunächst einmal stellt sich die Frage nach der Daseinsberechtigung: Angenommen, die Angst verfolgt lediglich den Zweck des hinderlichen Ausbremsens und ist mehr Hirngespinst als sinnvolle Emotion – warum existiert sie dann überhaupt? Eigentlich wäre eine Emotion, die nichts tut, als zu stören, ja nicht besonders sinnvoll. Schauen wir uns aber die Evolution an, so fällt schnell auf, dass unnütze, gar störende Attribute stets durch die Natur ausselektiert werden und in allen Entwicklungen Sinn und System steckt. Folglich muss es also irgendeinen konkreten Nutzen geben, den wir Menschen aus der Angst ziehen.
Werfen wir einen Blick auf die in uns ablaufenden Vorgänge, wenn wir uns fürchten: Der Sympathicus ist aktiv, die Pulsfrequenz steigt, die Pupillen weiten sich, die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet. Das führt dazu, dass wir extrem wach und fokussiert sind, weshalb uns die Angst nach dem Horrorfilm auch den Schlaf raubt. Man ist also aufmerksam und der Hormoncocktail steigert zudem die Leistungsfähigkeit, sodass man sowohl physische als auch kognitive Höchstleistungen zu vollbringen vermag. Dies war vor allem für unsere Vorfahren von großer Relevanz, da in einer Gefahrensituation innerhalb kürzester Zeit zwischen Flucht und Kampf (von Fachleuten auch als flight-or-fight-response bezeichnet) entschieden werden musste. Gegenteilig des allgemeinen Konsenses führt die Angst also nicht zu einer temporären Atrophie unseres kognitiven Vermögens, sondern erweitert es vielmehr parallel zu unserem körperlichen Leistungsvermögen. Gleichwohl kann man die Angst in diesem Kontext als Schutzmechanismus aufgreifen, der sich in unserer Vorzeit entwickelt hat. So zum Beispiel die Angst vor Spinnen, welche vielen Leuten bekannt ist, oder die Angst vor der Höhe, die in früherer Zeit dazu dienen sollte, die Menschen vor eben solchen Gefahren zu bewahren.
Schön und gut, mag sich nun der ein oder andere denken, aber diese Erklärung rechtfertigt doch lediglich die banalsten aller Ängste. Was ist zum Beispiel mit unserer panischen Angst vor Terroranschlägen oder Naturkatastrophen, die nachgewiesenermaßen weitaus weniger wahrscheinlich sind, als Opfer eines Blitzeinschlags zu werden? Wie verhält es sich mit der weitverbreiteten Angst vor dem Fliegen, obwohl diese Art der Fortbewegung um ein Vielfaches sicherer ist, als in ein Auto zu steigen? Man kann doch offensichtlich nicht abstreiten, dass die Ängste unsere Gesellschaft irrational sind.
Jenen Leuten rate ich, sich doch erstmal das Wort irrational etwas genauer anzuschauen, eine Begriffsklärung vorzunehmen. Ganz einfach geht das, bereits im Duden findet man folgende Bedeutung: Als irrational bezeichnet man Sachverhalte, die man mit der Vernunft, dem Verstand nicht fassen und begreifen kann, etwas, was einer logischen Denkweise nicht zugänglich ist. Wenn man nun die Einordnung von Risiken, wie die Mehrheit der Menschen sie vornimmt, betrachtet, so erscheint das zunächst nicht sonderlich logisch, da Statistiken belegen, dass unsere Ängste sich genau gegen jene Dinge richten, deren Eintritt am wenigsten wahrscheinlich ist. Im Rückblick auf die eben genannte Definition wären sie, oder zumindest die Tatsache, dass diese Ängste ausgeprägter sind als solche, welche sich gegen akutere Gefahren richten, also weitestgehend irrational. Wer sich aber mit dieser Folgerung schon zufriedengibt, der hat noch nicht tief genug geschaut, denn die Frage, die sich nun unweigerlich aufdrängt, ist die, woher diese falsche Einstufung und damit die Ängste denn rühren, wenn nicht aus einer rational quantifizierbaren Gefahr. Sind sie nur eine vollkommen unlogische, zufällige Entwicklung? Nach dem vorherigen Erklärungsansatz wäre die Antwort darauf ja. Normalerweise haben Situationen oder Sachverhalte aber einen Auslöser, dessen Folge sie sind. Geht man nun davon aus, dass dies auch hier der Fall sein muss, so fehlt uns bei unserer Kausalkette ebenjener Auslöser. Wenn man sich auf der Suche nach diesem die empirische Verteilung der in den Medien thematisierten Inhalte zu Gemüte führt, so fällt auf, dass Terroranschläge, Flugzeugabstürze und dergleichen viel öfter und in ausführlicherer Façon behandelt werden als die Anzahl der Autounfälle oder Blitzeinschläge. Dadurch wird suggeriert, das von ersteren aufgrund der ausführlicheren Abhandlung eine deutlich erhöhte Gefahr ausgeht als von realeren Gefahren. Genauso verhält es sich mit der Angst, die uns erfasst, nachdem wir einen Horrorfilm geschaut haben. Unterschwellig vermitteln diese unserem Gehirn den Eindruck, das von alten, leerstehenden Häusern, dunklen Kellern und nächtlichen Spaziergängen und dem Dunkel unter unserem Bett eine tatsächliche Gefahr ausgeht. Die Ängste, die sich durch den Medienkonsum entwickeln, entsprechen zwar größtenteils nicht der realen Gefahrenverteilung, sind aber trotzdem nicht irrational – denn sie begründen sich auf dem Abbild der Realität, welches uns Medien bieten. Dass dieses Abbild ein verzerrtes ist und nicht der Wahrheit entspricht, führt dazu, dass eine logische Schlussfolgerung unseres Gehirns aus den Medien nicht analog zu einer logischen Schlussfolgerung aus der tatsächlichen, unverfälschten Realität ist, mindert aber nicht seine Rationalität – der irrationale Schritt liegt nicht in unserem medienbasierten „risk assessment“ und der daraus resultierenden Angstentwicklung, sondern in der medialen Themengewichtung.
Daher sollten wir vielleicht, statt an der scheinbaren Irrationalität unserer Ängste zu verzweifeln, vielmehr die erschreckende Verzerrung der Realität durch die Medien mit ihren fatalen Auswirkungen auf unser Denken und Einschätzen, sowie den extremen Einfluss und damit auch die Macht die ebenjene Medien über die Gesellschaft verfügen, fürchten. Wäre das nicht eine Angst, die zu haben wirklich unbestreitbar rational ist?
Ebenso wenig irrational ist es, Angst vor dem Neuen und dem Unbekannten zu haben. Egal, ob es nun Angst vor dem Genmais, vor künstlicher Intelligenz oder einfach vor einer Veränderung des gewohnten Habitus ist – Ein Schritt ins Unbekannte muss zwar nicht, kann aber unbekannte Gefahren bergen, die sich im vorhinein schwer abschätzen lassen. So hat eine gesunde Portion Skepsis bereits unsere Urahnen vor dem unbefangenen Verzehr mitunter tödlicher unbekannter Nahrungsmittel bewahrt und hilft auch heute noch – sofern diese Angst nicht in pauschale Ablehnung und Panik mündet, in ähnlicher Manier nicht bedingungslos alles Neue zu akzeptieren, sondern stets kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, damit auch in Zukunft kein überambitionierter Wissenschaftler die Weltbevölkerung versehentlich durch eine unbemerkte, fatale Genmutation bei seiner neuentwickelten Getreidesorte ausrotten kann.
Unsere Ängste als kindische Schwächen abzutun, sie auszulachen und in den Dreck zu treten, wäre in jedem Fall also nicht rational, nicht gerechtfertigt. Denn wie bereits Friedrich Schiller sagte: Wer nichts fürchtet, ist nicht weniger mächtig als der, der alles fürchtet – Der mutige Held ist durch seinen Mangel an Angst ebenso kopflos wie der, der sich von seinen Befürchtungen übermannen lässt.
Ali Baba und die 40.273 Treffer – Mit Ad-Blocker und Suchmaschine auf dem Weg zur Wahrheit – Anika Corban
„Entschuldigung, könnten Sie mir kurz zeigen, wo ich die Formel für thermische Strahlung finde?“. Eine hoffnungsvolle Frage nach elenden 15 Minuten gefüllt von Haare-Raufen, Kaffee-Schlürfen und sachtem bis vehementem Klopfen gegen die eigene Schädeldecke, die jedoch allesamt mein Gehirn nicht befähigen konnten, sich an die dumme Formel zu erinnern. Und langsam möchte ich mal mit meinen Physik-Hausaufgaben fertig werden. „Natürlich – folgen Sie mir einfach kurz…“ erwidert die Bibliothekarin mit einem Lächeln und schlängelt sich hinter ihrem Tresen hervor. Doch noch bevor sie diesen ganz umrundet hat, springt von links ein aufgelöster Mann Mitte 50 zwischen uns. „Sie suchen Heizstrahler? Da habe ich genau das Richtige für Sie, nur 24,99€, wenn Sie einfach kurz hier…“ – genervt schiebe ich mich an ihm vorbei, nur, um direkt einer älteren Frau in die Arme zu laufen: „Wussten Sie, dass neueste Studien elektrische Heizstrahler mit Krebs in Verbindung setzten? Probieren Sie doch stattdessen mal Kirschkernkissen, biologisch und…“ – meine Verteidigung wird vehementer, unter Zuhilfenahme meines Ellenbogens kämpfe ich mich hinter der Bibliothekarin her, vorbei an einem jungen Mann, der mir entspannt erklären möchte, wann thermische Strahlung das erste Mal mathematisch formuliert wurde, allerdings auslässt, WIE diese Formulierung aussah, und einem älteren Mann im Laborkittel, der eine gekürzte Fassung derselben Erklärung zum Besten gibt. Endlich, sie deutet mit einer Handbewegung auf eine Regalreihe, in der ich eine vielversprechende Formelsammlung aufschlage: „Die Energie der thermischen Strahlung kann mit guter Näherung über E =…“ – eine junge Frau knallt mir den Wälzer direkt vor der Nase zu und wendet sich mir dann mit zuckersüßem Lächeln zu: „Interessiert an einem Premium-Abonnement?“. Weshalb probiere ich das eigentlich überhaupt noch mit Google?
Es gibt viele gute Gründe, sich darüber aufzuregen, dass Google seine Sulchalgorithmen nicht transparent und anpassungsfähig machen muss. Die Forderung tatsächlicher Transparenz, der Anspruch, die eigene Filterblase wenigstens visualisieren zu können, auch der Wunsch, das Verhältnis von hochqualitativem Inhalt zu finanzieller Ausstattung der angezeigten Links einschätzen zu können, gehören zu den guten – zu den effektiven Gründen zählen allerdings oft die kleinen, irritierenden: Weshalb muss ich auf die zweite Seite weitergehen, um bei der Anfrage „thermische Strahlung Formel“ überhaupt irgendeine Formel zu finden? Und – weshalb wird mir auf der Suche neben nervigen Anzeigen ausgerechnet der Imkerverein Bremen vorgeschlagen? Alle diese Gründe fassen jedoch das gleiche Phänomen, eine Suchmaschine, die sich immer weniger zum Suchen eignet. Unsere Bibliothekarin ist inzwischen weniger Expertin als Pariser Touristenführerin zweifelhafter Moral geworden, die uns zunächst einmal an allen ihr nahestehenden Souvenir-Läden vorbeischleust und nur mit viel Glück nach undefinierter Zeit tatsächlich zum Eiffelturm bringt.
Also laufen wir lieber auf gut Glück der sichtbaren Turmspitze nach…? Dann muss es eben ohne Fremdenführer gehen – ach, was war jetzt noch gleich die Adresse meiner Sparkasse? War es kreissparkasse-böblingen…oder ksk-böblingen…oder doch kreissparkasse-bb? Zu spät, schon hat man sich verlaufen und die Spitze des Turmes, die kann man schon lange nicht mehr sehen. Google hat seine Hausaufgaben gründlich gemacht, so gründlich, dass eine Internet-Recherche ohne Goggle kaum möglich geworden ist und ein Großteil der Generation Ü60 keinen klaren Unterschied zwischen den Begriffe „Google“ und „Internet“ erkennen kann. Es gleicht dem Moment des stillen Eingeständnisses, dass die Duolingo-Französisch-Kenntnisse doch nicht ausreichen – und so wenden wir uns im Paris-Urlaub mit Reue dem Englischen zu und googeln „Kreissparkasse Böblingen“. (Anmerkung – sonst hätte es auch noch sehr, sehr lange dauern können. Es ist „kskbb“.)
Ohne Google geht es also nicht, doch wie sollen wir uns dann den Weg durch den Link-Dschungel bahnen? Die Ad-Blocker-Machete in der Hand geht es schon etwas besser, aber um eine Erkenntnis kommt man einfach nicht herum: Unter den Millionen von Links ist vielleicht der eine wichtige frei zugänglich geworden, aber die anderen 999.999 halten sich für genauso einzigartig und relevant. Hat das Internet die Suche nach Informationen am Schluss nur um ein Vielfaches erschwert? Werfen wir einen Blick zurück, schwelgen wir in der Erinnerung an einfachere Zeiten. Wir, na ja, des Schreibens mächtige Mönche tausende Fuß entfernt, schreiben das Jahr 1453. Wahrheit ist ein simples Prinzip, denn die Auswahl ist begrenzt. Wir haben die berauschende Meinungspluralität des all-sonntäglichen Marktschreiers auf der einen, des etwas-seltener-sonntäglichen Priesters auf der anderen Seite, und nicht zu vergessen die Weisheiten des Familienältesten, die sich allerdings für gewöhnlich auf „Als ich noch jung war, da…“ beschränken. Wäre einem hier der Imkerverein Bremen vorgeschlagen worden, wäre das vermutlich eine relevante Option gewesen.
Wenn der Blick zurück eines offenbart, dann, dass die Suche nach ein wenig Wahrheit nie eine einfache war. Die Menschheit hat es erfolgreich geschafft, die Meinungs- und Informationsäußerung erst vom Lautstärkepegel des eigenen Organs abhängig zu machen, um dieses System zugunsten eines Rankings je nach Fähigkeit, sich einer äußeren Doktrin vollständig zu unterwerfen und deren Glaubenssätze zu predigen, über den Haufen zu werfen. Mit dem Buchdruck konnte plötzlich jede weltbewegende Erkenntnis vervielfältigt werden, jedenfalls, wenn deren Urheber das nötige Kleingeld oder einen einflussreichen Best Buddy besaß. Dieses Regelwerk hat sich bedeutend zu lange gehalten, weitergezogen in eine Zeit, in der der Journalismus zwar jedem offen stand, der Chefredakteur allerdings mit einem teuren Weinchen gewillt sein konnte, den ein oder anderen Artikel unter den Tisch fallen zu lassen.
Und fast wichtiger: Was nutzt schon eine freie Äußerung, wenn dem Empfänger die Ohren zugehalten werden? Es ist die wahre Leistung und gleichzeitig wohl auch das schreckliche Vermächtnis des Internets, dass unter der Voraussetzung eines vorhandenen Endgeräts eine breite Palette an Informationen orts-, zeit- und finanziell unabhängig geworden ist. Für die Tageszeitung war nicht jeder bereit, zum Portemonnaie zu greifen, aber das ist inzwischen nicht mehr nötig. Fast könnte man meinen, wir hätten Jahrtausende daran gearbeitet, den Informationsfluss zu formen, zu regulieren, und uns nun entschieden, wieder alle auf dem digitalen Marktplatz zu versammeln. Nur gibt es keinen Marktschreier mehr – wir haben einfach jedem Anwesenden ein Megafon in die Hand gedrückt. Wer sich hier durchsetzen will, dem hilft kein Stimmumfang mehr, nur ein freundlicher Blick zu unserer Touristenführerin, die inzwischen besonders leistungsstarke Lautsprecher und Mikrofone verkauft. Schöne neue Welt, nicht?
Dennoch ist die Macht des Marktplatzes nicht zu unterschätzen: Zum ersten Mal in der langen Geschichte von geltungsbedürftigen Besserwissern stehen wirklich ALLE beisammen – der Oxford-Professor, der 3.-Semster-Student, die Naturheilkundlerin von nebenan und deine Mutter, die dieses ganz tolle Suppenrezept von ihrer Nachbarin bekommen hat. Und sie alle haben eine Chance, zu sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Wer glaubt, dass für die Wahrheit ein einziger Blickwinkel ausreicht, der hat noch nie darüber nachgedacht, dass seine alt-bekannten Sternbilder nicht in einer Ebene liegen. Von ein bisschen weiter oben ist sein Kleiner Bär nämlich eher eine langgestreckte Klapperschlange, und zwischen zwei benachbarten Sternen können Lichtjahre liegen. Jede zusätzliche Perspektive ist eine wichtige, wenn wir unser Tausend-Teile-Puzzle jemals vollenden wollen. Alle Teilchen gesammelt haben wir jetzt endlich – nur für das Zusammensetzen, da ist uns irgendwie noch nichts richtig Geniales eingefallen.
Denn seien wir ehrlich, eigentlich wollen wir in der Bibliothek keinen personalisierten Vorschlag, der sich daran orientiert, dass wir hier das letzte Mal waren, als in der 7. Klasse unsere Kunstlehrerin partout ein richtig echtes Buch als Quelle für die GFS verlangt hat. Weder mein zu Teilen irritierender Suchverlauf noch potentiell die Möglichkeit, sich dem Google-Konzern anzuschließen und unterzuordnen, was in gewisser Weise ein ähnlich unangenehmer Mäzen wie die katholische Kirche sein dürfte, zählen für mich zu der Liste an guten Gründen, weit oben im Suchverlauf angezeigt zu werden. Auch regelmäßiger Traffic der Seiten scheint mir bei genauerer Betrachtung ein inzwischen eher abstruses Prinzip zu sein: Verkaufszahlen von Büchern mögen ja ein gutes Kriterium zur Abschätzung der Popularität sein, aber ob die „DIY: Feenstaub“-Seite jetzt eine Million Klicks hat, ist ziemlich irrelevant, wenn 999.999 Besucher die Seite entnervt nach durchschnittlich 27 Sekunden verlassen haben, weil ihnen das Kleinhäckseln von Papas Schallplatten im Thermomix dann doch nicht gerade wie eine umwerfende Idee vorkam – ein Kondolenzschreiben an den Vater des Millionsten Besuchers, der das gar nicht so abwegig fand. Und spätestens, wenn seriösen Journalisten bei einem Artikel über Glasfaserkabel vom hauseigenen SEO-Team (Search Engine Optimization) vorgeschlagen bekommen, doch vielleicht den Begriff „Fake News“ einzubauen, der hätte damit zwar nichts zu tun, wäre aber gerade „so was von trendig“, dann kann mir niemand mehr erzählen, die Suchalgorithmen wären doch eine gute Sache.
So stehen wir also hier, vor über 40 Seiten voller Links, kategorisiert von einer allmächtigen und potentiell leicht zu manipulierenden sowie täuschenden Bibliothekarin, die sich zu allem Überfluss auch noch jede dumme Seite merkt, die wir je angeklickt haben, und uns immer noch ab und an versuchsweise eine kleine Baby-Katze vor die Nase hält, nur für den Fall, dass wir mal wieder in der Stimmung wären, 5 h vor Videos von fremden Kätzchen zu verbringen. Irgendwo auf Seite 37 ist bestimmt eine seriöse Studie zum gesuchten Thema, und trotzdem landet man in seiner Verzweiflung wieder bei Wikipedia, der Seite, über die einem eingetrichtert wurde, ihr niemals zu vertrauen, und die als einzige irgendwie zu allem etwas sagen kann. Und wenn ich es mir recht überlege, die auch das beste Beispiel für das ist, was das Internet für unsere Suche nach ein wenig Wahrheit wirklich leisten könnte.
Wikipedia ist tatsächlich genau das, was dem Marktplatz gefehlt hat. Statt hämisch grinsend mit Mikrofonen und Lautsprechern das Chaos weiter anzutreiben, ist Wikipedia der Streber, der es trotzdem irgendwie schafft, alle zu Handzeichen zu motivieren. Hier ergänzt jeder mit seinem Wissensteilchen das Puzzle der anderen, und wer glaubt, ein wenig Schwachsinn verbreiten zu können, wird kollektiv sofort mit einem „Klappe, Ingo!“ auf seinen Platz verwiesen. Es mag eine Zeit gegeben haben, in der man tatsächlich glauben konnte, dass eine Online-Plattform, die auch dem „Lügenpresse“-brummelnden Nachbarn offensteht, qualitativ niemals an seriöse Fachbücher heranreichen können. Heute allerdings zeugt diese Überzeugung eher vom Unwillen, der Realität auf den Bildschirm zu blicken: Selbst deutschlandweite Schülerwettbewerbe, die von international anerkannten Bildungseinrichtungen herausgegeben werden, basieren ihre Aufgaben inzwischen auf Wikipedia – und zwar nicht auf den Nerd-Informationen im dritten Unterkapitel, nein, direkt auf dem Einleitungssatz.
Denn genau das kann der Online-Zugang leisten: Er katalysiert alle ungenutzte Energie der Besserwisser dieser Welt, die diese ansonsten mit der detailgetreuen Nachbildung von Minas Tirith in Minecraft verbringen würden, auf eine nie endende Aufgabe – ein letztes zu lösendes Puzzle, diese eine Lücke in der Wikipedia-Kugel. Und so sammelt sich dort alles, von mathematischen Beweisen der Lorentzkraft über die Relativitätstheorie bis zur „Reductio ad Hitlerum“. Und ob man es glaubt oder nicht, in durchschnittlich drei bis zwölf Sprachen sind diese Artikel nahezu immer korrekt. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach – irgendwo auf der Welt ist es gerade immer zwischen 11 und 3 Uhr nachts und ein unterbeschäftigter Grammatikfan hat nichts Besseres zu tun, als Wikipedia-Artikel zu revidieren.
Dabei ist Wikipedia nicht das einzige Erfolgskonzept dieser Art: Auch Seiten wie Chefkoch demonstrieren, dass „zusammen“ ein funktionierendes Konzept bilden kann. Eigentlich überraschend: Wenige Bücher besitzen eine so sagenhaft niedrige Effizienz wie Kochbücher, sie werden meist zu höchstens 30 % relevant verwendet, selbst diese 30 % überzeugen zu höchstens 60 % und kosten dabei nie weniger als 15€. Essenziell macht man hierbei mit geringstem Aufwand ein enormes Geld, und trotz Bewertungen, die ehrlich verfasst nie mehr als 3 von 5 Sternen umfassen sollten, scheint das Konzept noch immer zu funktionieren. Und dennoch überlebt Chefkoch – wo genau dieser Inhalt (mit deutlich überdurchschnittlichen Bewertungen!) tausendfach kostenfrei hochgeladen wird. Zugegebenermaßen, Chefkoch hat den Heimvorteil eines prädestinierten Klientels: Wer wäre williger, aus dem eigenen Können kein kapitalistisches Konzept zu entwerfen, als Oma Gertrud, die ohnehin schon immer beweisen wollte, dass ihr Pflaumenkuchen mindestens doppelt so gut wie der von Gerlinde ist (Anmerkung: Tatsächlich, 5 zu 2 Sternen). Dennoch ist es beeindruckend, wie qualitativ hochwertig die kostenlose Beteiligung tausender Mitglieder werden kann. Wenn der Weg zur Wahrheit nur über die geordnete Sammlung kollektiven Wissens führt, dann sind wir der Wahrheit guter Küche mit Chefkoch ein ganzes Stück nähergekommen.
Und ja – trotzdem sinkt die Qualität des Journalismus auf den Online-Seiten der großen Zeitungen. Ja, Youtuber werden zunehmend von Konzernen bezahlt. Ja, Online-Foren driften viel zu schnell gemäß Godwin’s Law ab. Aber der Hoffnungsschimmer der Erfolgsgeschichten bleibt bestehen. Sie sind es, die uns zeigen können, dass die Suche im Internet vielleicht schwerer wirkt, tatsächlich aber als Fortschritt gesehen werden kann: Unser Weg ist nicht länger geworden als er ohnehin war, wir haben nur endlich die Pflastersteine gesammelt, aus denen wir ihn tatsächlich bauen könnten. Deren Masse mag verwirrend wirken – aber ohne Fundament geht es eben nicht.
Und eines magischen Tages haben wir es vielleicht tatsächlich geschafft, einen wahrhaft freien Informationsfluss wahrhaft wahrer Daten zu erzeugen. Es mag ein sehr schwacher Schimmer einer kleinen LED sein, aber er ist da, und mit unseren Armeen von Routern und Smartphones haben wir das erste Mal zumindest eine Chance. Hier ist nicht die Zeit für eine Diskussion über Utopien, nur der Raum für eine Feststellung: utopischen Hoffnungsschimmern läuft man eigentlich immer nur nach. Aber das ist auch okay. Es ist okay, wenn wir weiter Wikipedia-Artikel korrigieren müssen, wenn wir uns weiter durch die Treffer und Anzeigen graben müssen, um endlich ein wenig Wahrheit zu finden – und bei Wikipedia direkt mal die Korrektur anwerfen müssen. Denn nur dafür sind Utopien da – fürs Weitersuchen, Weiterleiten, Weiterlaufen.





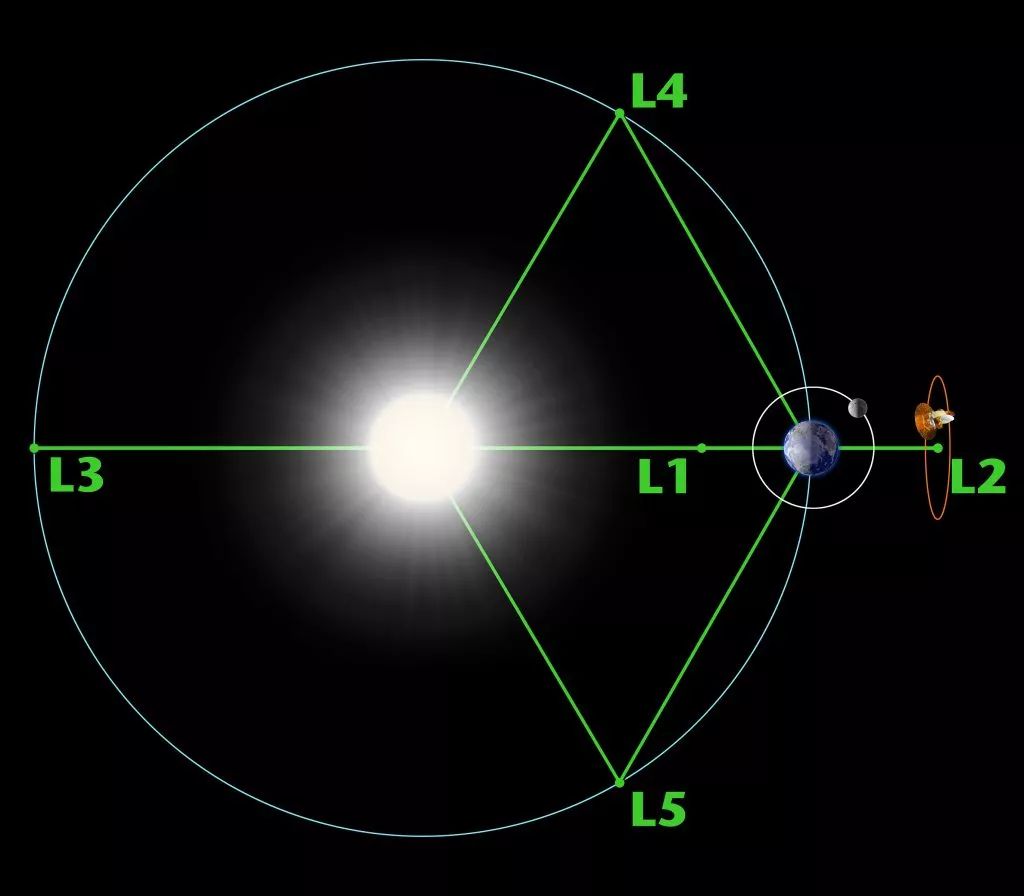
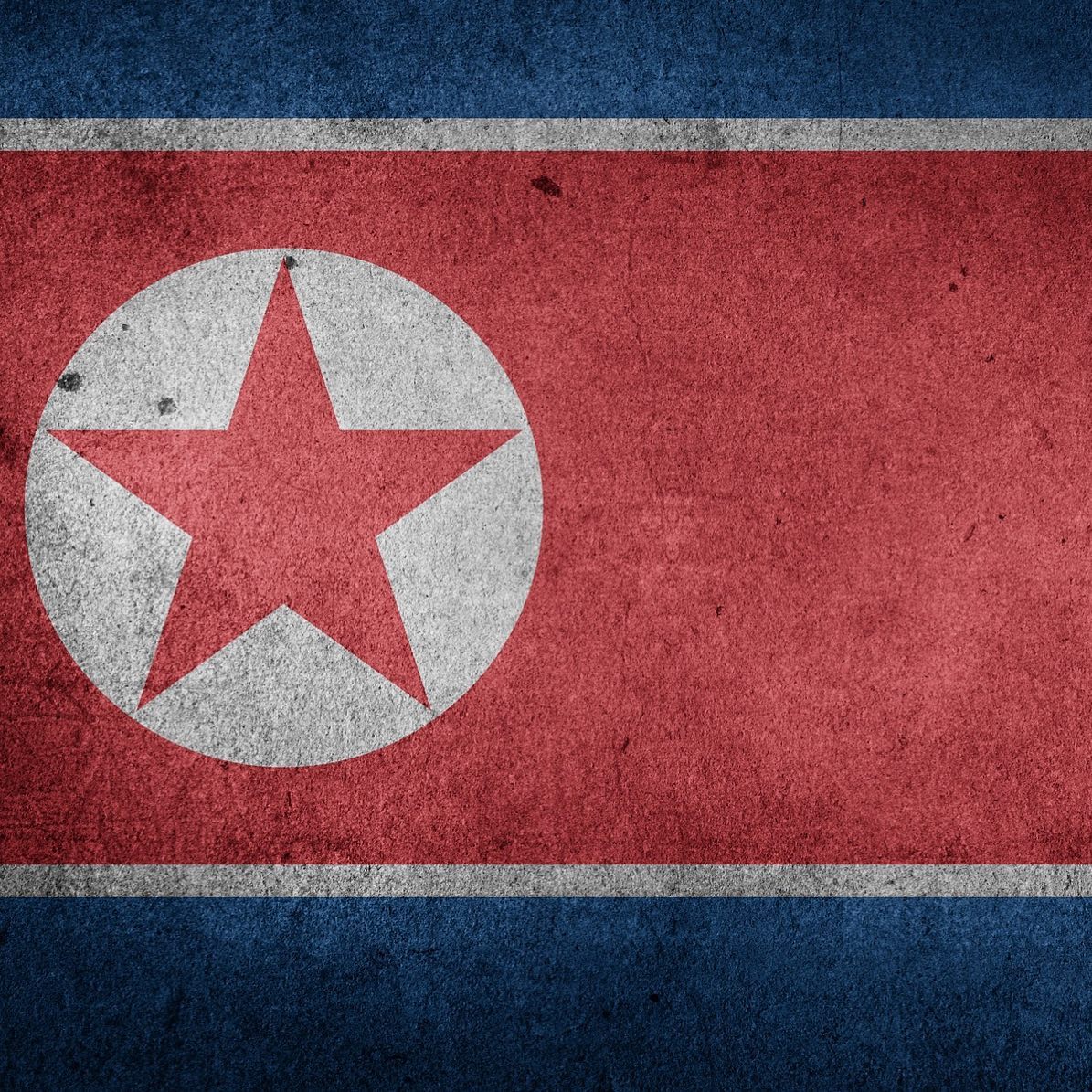







Neueste Kommentare