 Lachen ist ja bekanntlich gesund. Es sorgt nicht nur für die Freisetzung körpereigener Glückshormone, welche positive Gefühle und Euphorie hervorrufen. Es regt darüber hinaus auch den Stoffwechsel an und stärkt nachweislich die körpereigene Abwehr. Was liegt, wenn einem so etwas wie lebenslange Gesunderhaltung wichtig ist, also näher, als einen Beruf zu ergreifen, in dem Lachen zum Alltag gehört, in dem einen der tägliche Blick in selige und dankbare Kinderaugen mit Glück und Zufriedenheit erfüllt und der einem nebenbei noch genug Zeit für Familie, Freunde, Freizeit und Ausgleich lässt *räusper, die erste*? Doch wehe dem, der nichts Böses dabei denkt und mit rosaroter Brille auf die Berufswahl schaut, die ich (der, um dies vorweg zu nehmen, mit dieser Entscheidung bis heute sehr glücklich ist) vor vielen Jahren getroffen habe und die meine Schüler tagtäglich in den unterschiedlichsten personalen Variationen vorgesetzt bekommen. Ich bediene nur ungern die abgedroschene Metapher mit dem Eisberg, aber in diesem Beruf steckt tatsächlich viel mehr, als man denkt! Doch zunächst eine Rückblende …
Lachen ist ja bekanntlich gesund. Es sorgt nicht nur für die Freisetzung körpereigener Glückshormone, welche positive Gefühle und Euphorie hervorrufen. Es regt darüber hinaus auch den Stoffwechsel an und stärkt nachweislich die körpereigene Abwehr. Was liegt, wenn einem so etwas wie lebenslange Gesunderhaltung wichtig ist, also näher, als einen Beruf zu ergreifen, in dem Lachen zum Alltag gehört, in dem einen der tägliche Blick in selige und dankbare Kinderaugen mit Glück und Zufriedenheit erfüllt und der einem nebenbei noch genug Zeit für Familie, Freunde, Freizeit und Ausgleich lässt *räusper, die erste*? Doch wehe dem, der nichts Böses dabei denkt und mit rosaroter Brille auf die Berufswahl schaut, die ich (der, um dies vorweg zu nehmen, mit dieser Entscheidung bis heute sehr glücklich ist) vor vielen Jahren getroffen habe und die meine Schüler tagtäglich in den unterschiedlichsten personalen Variationen vorgesetzt bekommen. Ich bediene nur ungern die abgedroschene Metapher mit dem Eisberg, aber in diesem Beruf steckt tatsächlich viel mehr, als man denkt! Doch zunächst eine Rückblende …
Frühsommer 2003: Gegen Ende der neunten Klasse rückt auch für mich das Berufsorientierungspraktikum und damit der erste wirklich intensive Kontakt mit der realen Berufswelt in bedrohliche Nähe. (Einigen Lesern mag dieses Gefühl mit Sicherheit vertraut vorkommen. …) Um den eventuellen Schock dieser Ersterfahrung abzumildern, zerrt uns unser Klassenlehrer auf Geheiß der Schule zu einer Berufsberatungsveranstaltung in die örtliche Filiale der Bundesagentur für Arbeit. Dort sollen uns der Exkurs in die wirkliche Welt der arbeitenden Bevölkerung durch eine sachkundige Beratung durch die dortigen MitarbeiterInnen ein wenig leichter gemacht und Ängste vor Überforderung und kollektivem Scheitern oder ganz einfach der diffuse Zwang, nach dem ersten Praktikumstag mit den Beinen in der Hand auf und davon zu rennen, genommen werden. Eine der wesentlichen und den Damen und Herren der Agentur als am effektivsten erscheinenden berufsberatenden Maßnahmen besteht damals darin, den Schülern durch das Betrachten von Kurzfilmen einen Einblick in noch so skurrile Berufszweige zu verschaffen – und wir, wir können es kaum erwarten *räusper, die zweite*.
Auch wenn es jetzt abgedroschen klingen mag: Für mich steht damals bereits fest, dass ich Lehrer werden möchte. Pflichtbewusst begebe ich mich im örtlichen Medienregal umgehend und zielgerichtet auf die Suche nach dem entsprechenden Kurzfilm. Als ich gerade fündig geworden bin, grätscht mir allerdings die freundliche Dame von der Arbeitsagentur mit ihrem Berufsberatungseifer dazwischen. Sie erklärt mir, dass diesen Film zu schauen doch gar nicht nötig sei. Quasi Zeitverschwendung. Als Schüler würde ich doch tagtäglich Lehrer in ihrem beruflichen Alltag sehen und erleben können. Welchen realistischeren Eindruck als diesen könne es schon geben?
Januar 2012: Die Antwort auf diese äußerst naive Aussage besagter Dame erhalte ich spätestens jetzt, da ich am Beginn meines Vorbereitungsdienstes stehe. Als Lehramtsanwärter, wie man in dieser Phase offiziell genannt wird, wird man da sofort mit dem vollen Programm des äußerst vielschichtigen Berufsbildes „Lehrer“ konfrontiert und merkt schnell, dass der eigentliche Unterricht, also das, was Schüler tagtäglich von ihren Lehrern mitbekommen, nur einen Bruchteil der tatsächlichen Lehrerarbeit ausmacht. Hätte ich der Dame vom Arbeitsamt damals geglaubt, wäre ich womöglich mit mächtigen Scheuklappen in meinen Wunschberuf galoppiert. Der eigentliche Job fängt für uns Lehrer nämlich weiß Gott erst hinter den Kulissen an. Da wollen Konferenzen abgehalten und pädagogische Entscheidungen über einzelne Schüler gefällt und begründet, Schüler für Preise und Stiftungen ausgewählt, Empfehlungsschreiben verfasst, Nachteilsausgleiche besprochen und beschlossen, Tests und Klausuren korrigiert, mündliche Noten festgelegt und begründet, Notentabellen geführt, Noten berechnet, Emailanfragen beantwortet, Telefonate mit Eltern geführt, Elterngespräche und Tage der offenen Tür geplant und absolviert, Exkursionen und andere Veranstaltungen geplant und natürlich ganz nebenbei noch die Unterrichtsstunden für die kommenden Tage vorbereitet werden. Und wenn einen all das noch nicht vollends zum Überschnappen gebracht hat, ist da ja noch das Privatleben, von dem man uns im Vorbereitungsdienst erzählte, dass es schon wieder in den Lebensalltag zurückkehren würde, wenn man das Referendariat erstmal hinter sich gebracht hat. Wenn ich heute daran denke, glaube ich, dass die Leute, die mir das damals erzählt haben, mit der übereifrigen Dame in der Arbeitsagentur unter einer Decke steckten!
Januar 2016: Welche der unzähligen Aufgaben meines Berufes mir in der Zwischenzeit die liebsten geworden sind? Schwer zu sagen – da gibt es sehr viele! Was davon ich für das Schwierigste und Zeitaufwändigste halte? Ganz klar: Die Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern. Im Klartext: die Korrekturarbeit und das Erstellen mündlicher Noten, das Bewerten von Vorträgen und GFS. Da mag man sich als Schüler fragen, was am Häkchen setzen, am Fehler anstreichen, am Auswürfeln mündlicher Noten und dem Suchen nach scheinheiligen Begründungen für schlechte Noten bitte so schwierig und zeitaufwändig sein soll. Nun ja: Das mit unter vorerst notwendige Lesen der bereits angesprochenen geistigen Ergüsse der Schützlinge, deren wissenschaftlicher Bildung man sich verschrieben hat. Damit fängt das Unheil schon mal an. Und damit meine ich nicht einmal unbedingt den Nonsens, den so mancher Schüler oder so manche Schülerin in Klausuren mit unter so zu Papier bringt (was an unserer Schule Gott sei Dank nicht allzu häufig der Fall ist), wenngleich mir das schon so manchen befreienden Lachanfall beschert hat. Die eigentlich herausfordernde Arbeit beginnt schon beim Erstellen einer Klausur. Da ist zu entscheiden, wie viel Stoff man in die Klausuraufgaben packt, ohne die eigenen Schüler allzu sehr in die typische Schönbornsche Klausur-Zeitnot zu versetzen; wie groß die reproduktiven und wie umfangreich demgegenüber die Transferanteile in den Klausuraufgaben sein sollen, ohne die liebgewonnenen Prüflinge mit der sonst so erdrückenden Schönbornschen Transferaufgabenlast zu überfordern (und das alles manchmal nur, um danach, wenn alles gelaufen ist, festzustellen, dass man es wieder ein kleinwenig übertrieben hat *räusper, die dritte*); ob die Klausur zu vollgepackt ist, ob sie die Schüler unter enormen Stress setzt oder sie gar unterfordert, ob man an der richtigen Stelle der Klausur die richtigen Fragen korrekt formuliert und so gestaltet hat, dass der Schüler sie nicht nur versteht, sondern dass er in jedem Moment der Klausurbearbeitung in die Lage versetzt wird, einen maximalen Anteil seines Wissens abzurufen und preiszugeben, um die maximale Punktzahl zu erreichen. Wenn man die Klausurergebnisse dann schließlich vor sich liegen hat, geht die wirkliche Arbeit erst los. Da gibt es Schüler, die verpacken die zur Lösung einer 5-Punkte-Aufgabe geforderten Inhalte in drei oder vier knackig formulierte Sätze, während andere die geforderte Lösung auf anderthalb Textseiten nicht vollständig zu Papier und vor allem auf den Punkt bringen. Doch wie geht man damit um? Ist es fair, einem Schüler, der anderthalb Seiten zusammenhängenden Fließtextes produziert und zwei fachliche Kleinigkeiten vergisst, Punkte anzuziehen, und stattdessen jemandem, der sich diese Mühe nicht macht und die Lösung in wenigen Sätzen präsentiert, die volle Punktzahl zu geben? Oder muss man dem (notorischen) Vielschreiber, der nicht auf den Punkt kommen kann, für seine unnötig ausschweifende Textproduktion nicht gar pädagogisch abstrafen und ihn durch Punktabzug zwingen, sich beim nächsten Mal bitte unbedingt kürzer zu fassen? Und ganz egal wofür man sich entscheidet: Welche Auswirkungen hat das auf das Selbstbewusstsein des Schülers und seine zukünftige Leistungsbereitschaft? Gibt man ihm den halben Punkt am Ende vielleicht doch noch, damit die Gesamtpunktzahl zur besseren Note gereicht und ihn damit für seine Anstrengungen und Bemühungen belohnt und für die kommenden Klausuren motiviert? Man zerbricht sich über all diese und noch viele weitere Fragen regelmäßig den Kopf und kommt zu dem Schluss, dass all die palavernden Bildungswissenschaftler, die das Erteilen von Noten als Mittel der Leistungsbewertung als antiquiert, rückständig und am Ende sogar schädlich für Kinder ablehnen, mit ihrer Behauptung Unrecht haben, dass Noten ganz und gar objektive Bewertungsmittel wären, bei denen jegliche Individualisierung verloren ginge. Wer so etwas behauptet, hat wahrlich noch nie vor einer Klasse gestanden. Im Gegenteil ist das Erteilen von Noten, wenn man es richtig und mit dem nötigen gedanklichen Aufwand tut, aus meiner Sicht eine der individuellsten Methoden der Leistungsbewertung überhaupt. Und welch klareren und prägnanteren Ausdruck sollte das Ergebnis dieser unter dem reichlichen Verbrauch von Hirnschmalz ablaufenden Bewertungszeremonie finden, als in Form einer einfachen und aussagekräftigen Zahl auf einer Skala, die sich der Schüler bei Bedarf jederzeit erläutern lassen und über die er sich mit anderen messen kann? Zumal dies mit unter durchaus viele Früchte trägt, wenn sich Schüler die mit unter notwendigerweise auch mal pädagogisch erteilten Viertelnoten und die Hinweise dazu zu Herzen nehmen, daran wachsen und sich vielleicht langsam, aber immerhin stetig steigern. …
Natürlich greift dies nicht bei allen Schülerinnen und Schülern. Natürlich erreicht man auf diese Weise nicht alle, die man durch eine wohl überlegte Notengebung gerne zu einer intrinsischen Leistungssteigerung animieren möchte. Aber wie ich spätestens im Verlauf meines zweiten Dienstjahres zu akzeptieren gelernt habe, muss sich der Lehrer manchmal auch einfach mal mit der Entfaltung „überfachlicher Kompetenzen“ zufrieden geben *ehrlich gemeintes Schmunzeln, die erste*, für die man als Bildungsbeauftragter zumindest mitverantwortlich zeichnet. Wenn ein Schüler, befördert durch seine ausgeprägte Reflexionskompetenz, bei Bearbeitung einer Klausur z. B. erkennt, dass es an der Zeit ist, den Lehrkörper mit ein paar wenigen geflügelten Worten davon abzuhalten, im Verlauf der Korrektur das rote Tintenfass an die Wand zu knallen, aus dem Fenster zu hüpfen und wild schreiend über den Campus zu rennen, mit Verzweiflung in den Augen, weil angesichts dessen, was da mit unter zu Papier gebracht wurde, sein pädagogisches Weltbild gerade in sich zusammen gebrochen ist. Da ist man froh, wenn Schüler selbstreflektiert und kritisch über die Pflichtaufgaben hinausgehende Fragestellungen wie etwa „Was ist braun und schwimmt am Meeresgrund?“ formulieren, und durch Rückgriff auf ihre ausgeprägten Problemlösekompetenz die Antwort „Ein U-Brot!“ gleich mitliefern. Wenn das nicht von selbstbestimmtem, empathischem und eigenverantwortlichem Handeln zeugt, was dann *ehrlich gemeintes Schmunzeln, die zweite*? Und ist dies nicht das höchste aller Lernziele, das für einen Lehrer weit über jedes Lehrplanziel hinaus am erstrebenswertesten ist? …
~Alexander Schönborn





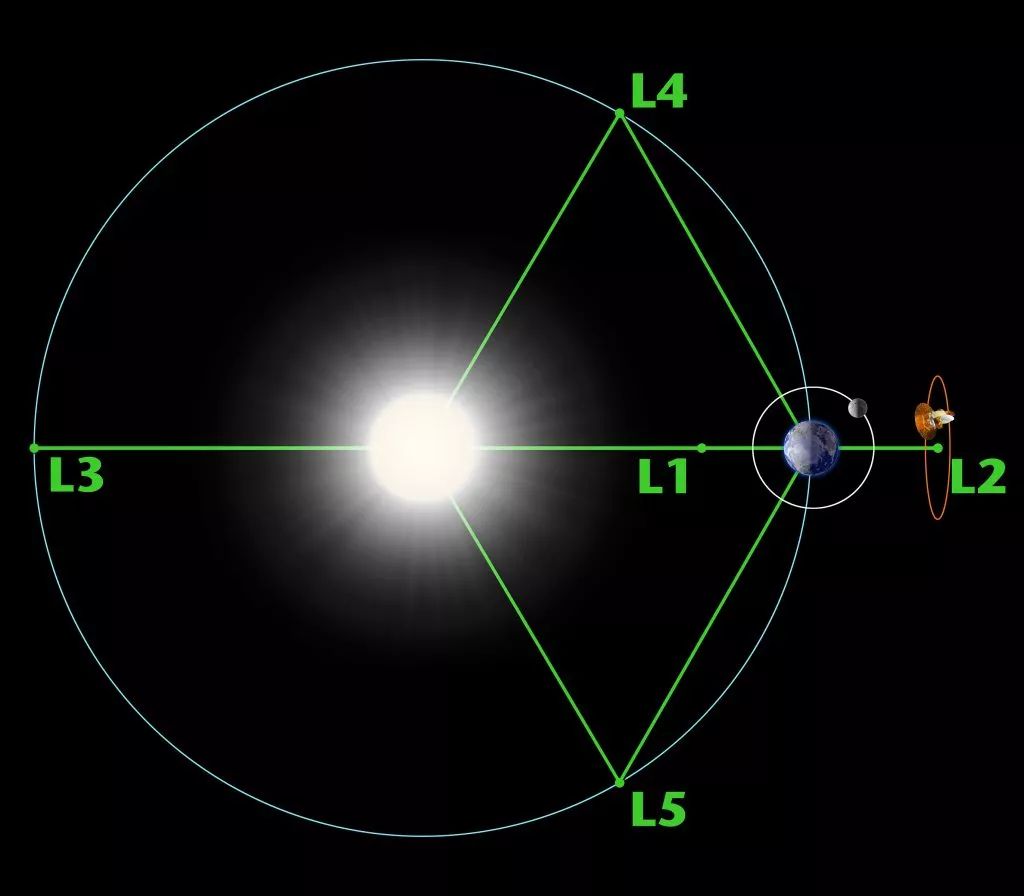
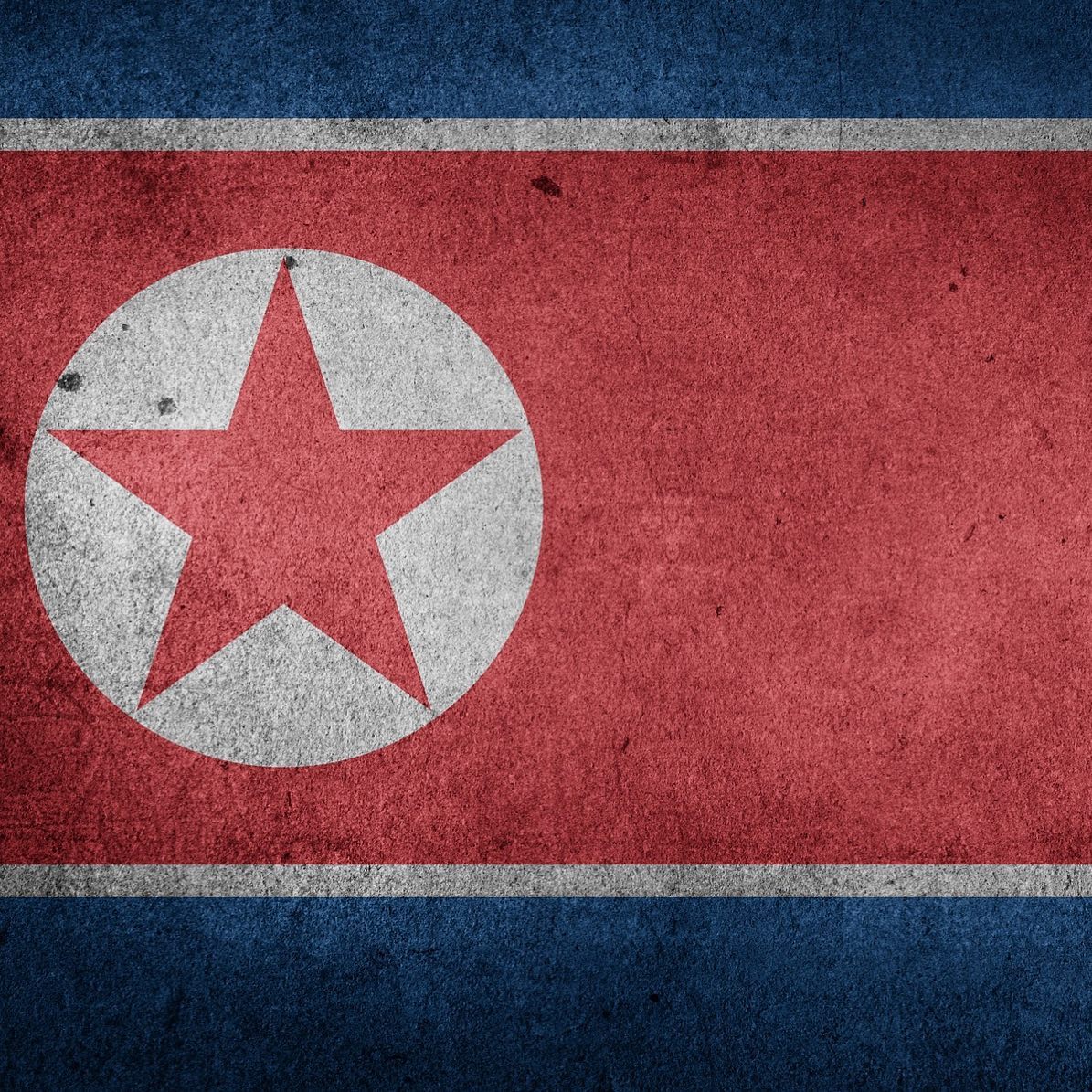







Neueste Kommentare